Thought Leadership
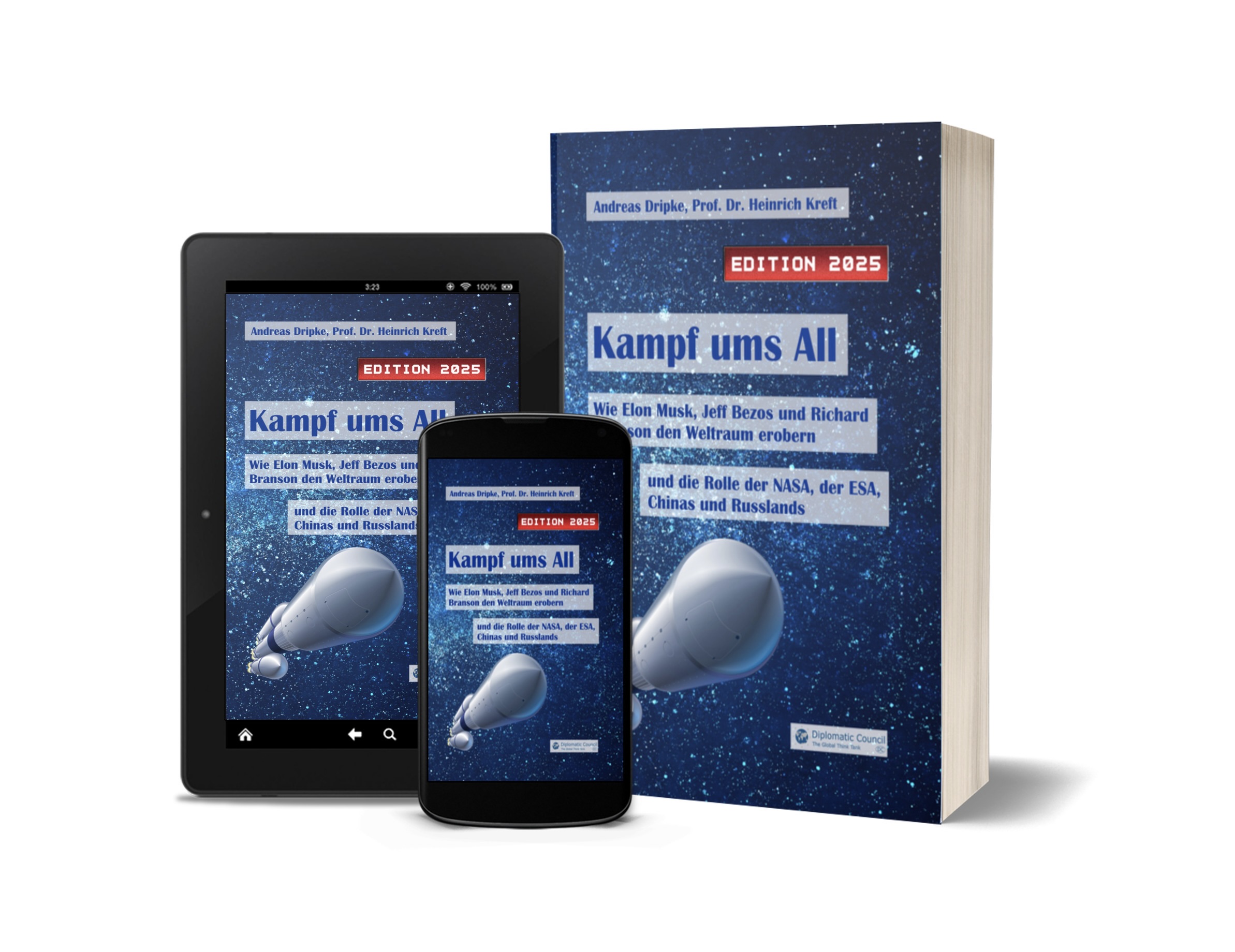
Die Ökonomisierung und die Militarisierung des Weltalls stehen im Fokus des neuen Buchs „Kampf ums All“, das der ehemalige deutsche Botschafter Prof. Dr. Heinrich Kreft gemeinsam mit dem Journalisten Andreas Dripke veröffentlicht hat (ISBN 978-3-98674-138-9). Auf 320 Seiten wird erklärt, „wie Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson den Weltraum erobern und welche Rolle die NASA, die ESA, China und Russland“ dabei spielen, so der ungewöhnlich lange Untertitel. Tatsächlich beleuchten die beiden Autoren beinahe alle Aspekte der Weltraumfahrt, von den ersten Anfängen über die veränderte Rollenverteilung zwischen staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren, Zukunftsmärkte wie Weltraumtourismus oder Space Mining, also den Abbau von Rohstoffen auf Asteroiden und Planeten, bis zur geplanten Besiedlung des Mondes und des Mars.
USA: Vorsprung durch grundlegend anderes Wirtschaftskonzept beim „Kampf ums All“
Den USA attestieren die beiden Autoren sowohl beim Raketenbau als auch beim Satellitenbetrieb einen Vorsprung, der von Europa nur schwer einholbar sei. So hinke Europas jüngstes Raketenmodell Ariane 6 (erster Flug 9. Juli 2024) hinter dem Pendant Falcon 9 der US-Firma SpaceX (erster Flug 4. Juni 2010) „mindestens eine Generation“ hinterher. Die Begründung: Ariane 6 ist eine Einmalrakete ohne wiederverwendbare Teile, während die erste Stufe und Teile der Nutzlastverkleidung der Falcon 9 zur Erde zurückkehren und bei einem nächsten Flug erneut zum Einsatz kommen können. Die Wiederverwendbarkeit gilt als entscheidender Kostenfaktor etwa beim Aussetzen von Satelliten im All. Das Starship von SpaceX (erster Orbitalflug 5. Mai 2021) ist rund doppelt so groß wie die Ariane 6 und kann etwa die fünffache Nutzlast ins All befördern. Genau wie die Ariane 6 kämpft derzeit auch das Starship noch mit technischen Schwierigkeiten, so dass Testflüge verschoben oder es gar zu Explosionen kommt. „Aber sobald die Kinderkrankheiten ausgemerzt sind, verfügen die USA mit dem Starship über eine Rakete, die der Ariane 6 um zwei Generationen voraus ist“, ordnet Andreas Dripke ein.
Der Grund für den Vorsprung der USA liege in einem grundlegend anderen Wirtschaftskonzept beim „Kampf ums All“, heißt es im Buch. So setzt Europa weiterhin auf das früher auch bei der NASA praktizierte Cost-plus-Verfahren. Dabei entwickeln die staatlichen Weltraumagenturen in jahrelanger Kleinarbeit einen detaillierten Plan für eine Rakete oder einen Satelliten mit haargenauen technischen Vorgaben und beauftragen anschließend die althergebrachten Raumfahrtkonzerne wie Boeing, Lockheed Martin (früher Martin Marietta), Northrop Grumman, Airbus oder Arianespace, die Pläne nachzubauen. Dabei dürfen die Unternehmen auf die ihnen entstehenden Kosten einen Aufschlag von acht bis zehn Prozent als Gewinn einkalkulieren („Cost-plus“). Die Folge: Je teurer das Projekt und je länger es sich hinzieht, desto höher ist der Gewinn der Unternehmen. Es gibt also infolge des Geschäftsmodells überhaupt keinen Grund, eine Rakete möglichst billig zu bauen – im Gegengeil. „Solange Europa an diesem absurden System festhält, wird es beim Kampf ums All weiter ins Hintertreffen geraten“, befürchtet Dr. Heinrich Kreft, und fordert „Wir brauchen viel mehr Marktwirtschaft in der Weltraumfahrt!“
Der ehemalige deutsche Botschafter blickt auf die Historie: „1984 hat der damalige US-Präsident Ronald Reagan mit dem Commercial Space Launch Act die Weichen für eine marktwirtschaftlich getriebene Weltraumfahrt in seinem Land gestellt. 2015 machte Präsident Barack Obama mit dem Commercial Space Launch Competitiveness Act den Weg frei für die Kommerzialisierung des Alls und legte damit den Grundstein für einen Billionenmarkt. Unternehmer wie Elon Musk und Jeff Bezos nutzen diese historische Chance und haben sich mit SpaceX bzw. Blue Origin einen Startplatz in der ersten Reihe beim Wettlauf ins All verschafft.“
Serien- statt Einzelfertigung senkt die Kosten dramatisch
Wie die Veränderung von „Wettbewerb statt Cost-plus“ funktioniert, erläutert Co-Autor Andreas Dripke: „Auch SpaceX bekommt staatliche Aufträge, aber zu einem Festpreis, sodass das Unternehmen motiviert ist, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Die Kosten für einen Raketenstart liegen dank der Umstellung der Raumfahrtbranche auf marktwirtschaftliche Prinzipen im Jahr 2025 nur noch bei etwa einem Fünftel der Kosten von vor 15 Jahren.“ Er prognostiziert weitere drastische Kostenreduzierungen im Wettbewerb der neuen Generation von Raumfahrtfirmen. Andreas Dripke erklärt: „Das ist vergleichbar mit der Umstellung von Einzel- auf Serienfertigung bis hin zur Massenproduktion. So baut SpaceX etwa sechs bis acht Erststufen pro Jahr, rund 120 bis 140 Zweitstufen und um die 230 Triebwerke, wie sie in der Rakete Falcon 9 zum Einsatz kommen. Zum Vergleich: In ihren besten Zeiten baute die europäische ArianeGroup gerade einmal sieben Raketentriebwerke im Jahr.“
Erschwerend kommt in Europa das sogenannte Georeturn-Modell hinzu. Es verlangt, dass jedes europäische Land so viele Anteile an den Aufträgen für neue Raketen erhält, wie es zur Finanzierung beiträgt. Infolge des politischen Proporzes mussten für den Bau der Ariane 6 mehr als 600 Unternehmen aus 13 Ländern koordiniert werden. „Das ist weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll“, stellt Dr. Heinrich Kreft klar. Er ist überzeugt: „Nur wenn es der europäischen Weltraumfahrt gelingt, die politischen Fesseln abzulegen und die Kräfte der Marktwirtschaft zu entfesseln, wird Europa beim Space Race eine Rolle spielen.“ Nach Zählung der Autoren sind knapp 20 Unternehmen in Europa rund um die Entwicklung oder den Bau von Raketen beschäftigt. Nimmt man die Satellitenbauer und sonstigen Space-Firmen hinzu, käme man auf beinahe 500 Firmen, davon etwa 80 Prozent Startups. „Hierin liegt die Zukunft der europäischen Raumfahrt“, ist Dr. Heinrich Kreft überzeugt und nennt beispielsweise die deutschen Unternehmen Isar Aerospace, Rocket Factory Augsburg und HyImpulse, die besonders weit vorne im Space Race lägen.
„Der neue EU-Kommissar Andrius Kubilius hat es in der Hand, mit einer Weichenstellung zur Marktwirtschaft Europas Raumfahrt einen neuen Schub zu verschaffen“, wendet sich Dr. Heinrich Kreft an den seit Ende letzten Jahres amtierenden EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt. Dem geplanten europäischen Weltraumgesetz (EU Space Law) erteilt der ehemalige deutsche Botschafter eine klare Absage: „Die Regelung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Weltraumaktivitäten der EU wird Europa keinen Schritt im internationalen Wettbewerb voranbringen“, warnt er vor einer falschen Weichenstellung. „Wir brauchen mehr Markt und weniger Regulierung, nicht umgekehrt“, ist Dr. Heinrich Kreft überzeugt.
Satelliten so wichtig wie Raketen
Beim Space Race geht es nicht nur um Raketen, sondern ebenso sehr um Satelliten. In dem Buch zeigen die Autoren den Zusammenhang auf: Durch wiederverwendbare Raketen, die hohe Nutzlasten tragen können, verringern sich die Kosten für Satellitenstarts. Dass drei Viertel der rund 10.000 Satelliten, die derzeit rund um die Erde kreisen, zum Starlink-Netzwerk von SpaceX gehören, sei entscheidend dem Raketenvorsprung des Unternehmens zu verdanken.
„Für Europa ist der Vorsprung von Starlink schwer einholbar“, analysiert Dr. Heinrich Kreft. Zwar hat die EU im Dezember 2024 den Startschuss für ein vergleichbares Satellitennetzwerk (IRIS2) gegeben. Dieses soll jedoch mit nur 290 Satelliten lediglich den europäischen Kontinent abdecken und frühestens 2030 in Betrieb gehen. Für den neuesten Trend – die Satellitenkommunikation mit handelsüblichen Smartphones – ist IRIS2 nach Einschätzung der beiden Buchautoren nicht geeignet. „Mit IRIS2 hinkt Europa den USA auch bei der Satellitenkommunikation mindestens eine Generation hinterher“, urteilt Andreas Dripke.
Bessere Chancen zu Starlink aufzuschließen, räumen die beiden Autoren dem aufkommenden Satellitennetzwerk Kuiper der Weltraumfirma Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos ein. Seit 2024 produziert das Unternehmen bis zu 80 Satelliten im Monat in einer eigenen Fertigungsstätte. Der kommerzielle Start ist für Ende 2025 geplant. Kuiper soll in erster Linie als Satelliten-Backbone für Breitband-Datenverbindungen der Amazon Web Services (AWS) dienen. Andreas Dripke ordnet ein: „AWS ist heute schon der mit Abstand führende globale Marktführer im Bereich Cloud-Computing mit einem Marktanteil zwischen 30 und 40 Prozent. Mit Kuiper will Amazon diese Marktposition offenbar weiter ausbauen. Das Rennen um schnelle Internetanschlüsse aus dem Fall wird künftig wohl größtenteils zwischen Jeff Bezos‘ Kuiper und Elon Musks‘ Starlink stattfinden.“
Dr. Heinrich Kreft stellt klar: „Bei den globalen Satellitennetzwerken geht es weit über ökonomische Interessen hinaus um fundamentale geostrategische Sicherheitskonzepte. Das Spektrum erstreckt sich von der Drohnensteuerung in Kriegsgebieten wie der Ukraine bis hin zur Bereitstellung einer non-terrestrischen Kommunikationsinfrastruktur bei Naturkatastrophen auf der Erde.“ Er erinnert an die Worte „Wer die Kontrolle über das Weltall besitzt, der hat auch die Kontrolle über die Erde“ des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy aus dem Jahr 1960, „die heute wahrer sind als jemals zuvor“ (Dr. Heinrich Kreft). „Mit Starlink und künftig Kuiper hält jede künftige US-Regierung weit über die Amtszeit von Donald Trump hinaus ein Faustpfand in der Hand, dessen strategische Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann“, ergänzt Andreas Dripke.
Als Beleg für den „absoluten Machtanspruch der USA auf das Weltall“ wird in dem Buch unter anderem die Gründung der US Space Force angeführt. Die Angehörigen der Weltraumstreitkräfte, die Wächter (englisch: Guardians), sollen das Gebiet zwischen Erde und Mond, den sogenannten zislunaren Raum, lückenlos überwachen. Dies kommt einer Ausweitung der Reichweite gegenüber der bisherigen Überwachung durch geostationäre Satelliten etwa um das Tausendfache gleich. Bereits 2021 stellte das westliche Militärbündnis NATO klar, dass Angriffe im All, etwa auf die Satelliten eines Landes, den Bündnisfall auslösen, also als Attacke auf alle im Bündnis zusammengeschlossen Staaten gewertet werden.
Wie China als einziges Land den USA im großen Stil Paroli im All bietet, beschreiben Dr. Heinrich Kreft und Andreas Dripke in ihrem Buch ausführlich. So gingen 2024 gleich zwei mit Starlink vergleichbare Projekte mit geplanten 13.000 (Guowang) bzw. 14.000 (Spacesail) Satelliten rund um den Globus an den Start. „Chinas Raumfahrttraum, wie es Staatschef Xi Jinping ausdrückt, ist vergleichbar mit dem Machtanspruch der USA auf den Weltraum“, sagt Dr. Heinrich Kreft. Er ergänzt: „In Sachen Realisierung liegt China zwar hinter den USA, aber deutlich vor Europa“.
Marktnischen für Europa
Immerhin gibt es viele Marktnischen, in denen die europäische Weltraumfahrt Fuß fassen könnte, heißt es im Buch. So will die ESA das Schrottsammeln im All als „neuen kommerziellen Sektor der Raumfahrtindustrie entwickeln“. Schon heute umkreisen rund eine Million Brocken, die einen Zentimeter oder mehr messen, und etwa 5.000 Schrottobjekte mit einer Größe von mindestens einem Meter die Erde. Neben dem Schrottsammeln gilt auch der Start von Kleinraketen zur Beförderung von Kleinstsatelliten als lukrative Nische für europäische Weltraumfirmen. In Planung ist sogar ein Weltraumbahnhof in der Nordsee für dieses im wahrsten Sinne des Wortes kleinteilige Geschäft. „Im Vergleich zu den hochfliegenden US-Plänen nehmen sich die europäischen Nischen allerdings äußerst bescheiden aus“, sagt Dr. Heinrich Kreft.
